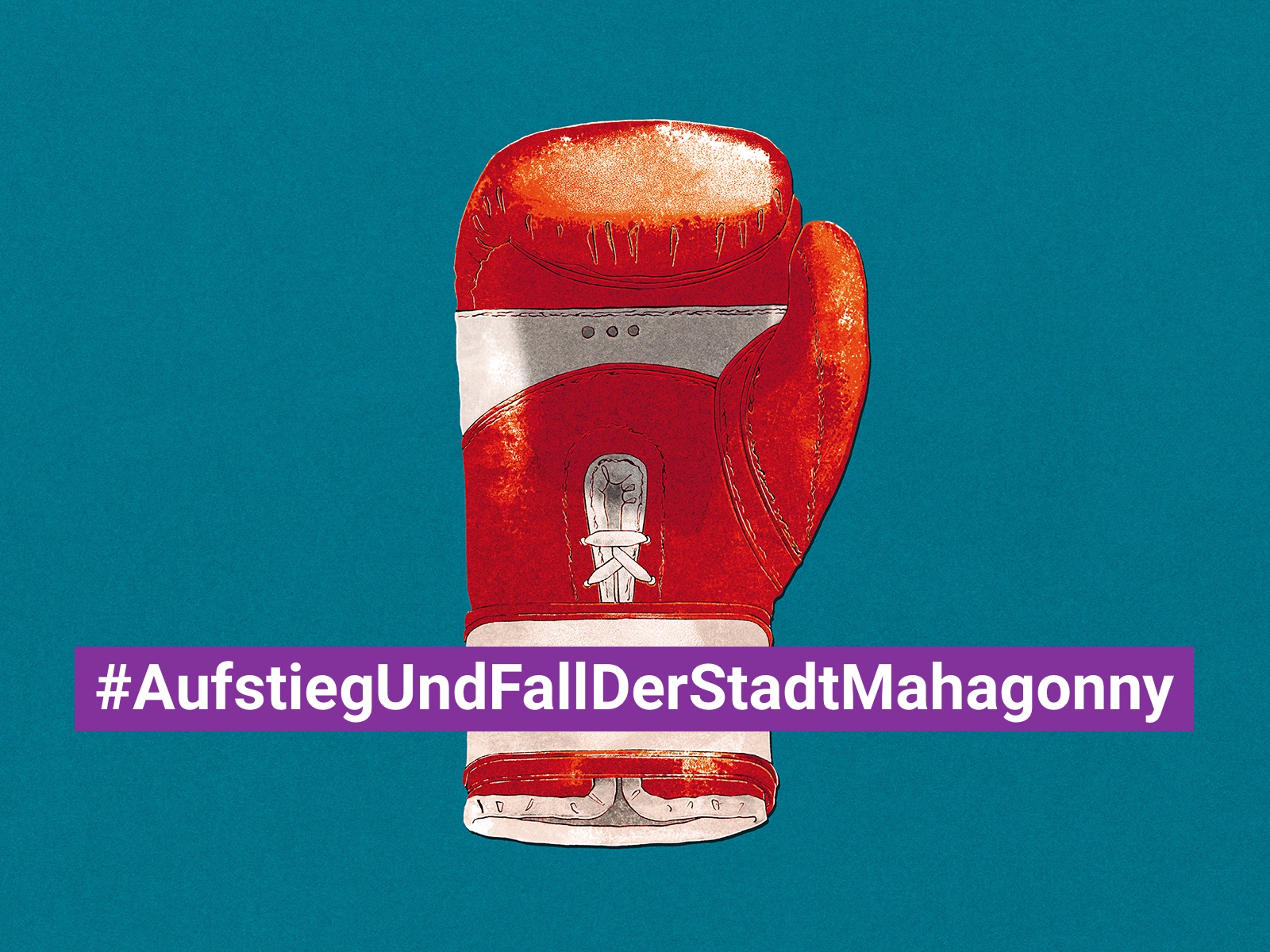Die Kunstform Oper gab es noch nicht, als Huldrych Zwingli 1519 sein Amt im Zürcher Grossmünster antrat. Sie entstand knapp hundert Jahre später an den reichen Fürstenhöfen im katholischen Italien, und es ist schwer vorstellbar, dass der strenge Zürcher Reformator sie gutgeheissen hätte. Die Oper ist bild- und prunksüchtig, von zweifelhafter Moral, ausschweifend, verschwenderisch, eitel, dem Genuss und der Sinnenlust des Diesseits mehr zugetan als den Versprechen auf das Jenseits. Gibt es Anti-Zwinglianerisches? Denkbar quer steht die Oper zu einer Bewegung, in deren Zuge Orgeln und Bilder aus den Kirchen entfernt wurden. Der einzig angemessene Beitrag des Opernhauses Zürich zum fünfhundertjährigen Jubiläum der Zürcher Reformation wäre also – im Sinne Zwinglis – eine vorübergehende Schliessung des sündigen Hauses. Eine Möglichkeit ist aber auch, das Geniesserische und Ausschweifende zum Thema machen.
In Bertolt Brecht und Kurt Weills Oper «Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny» entdeckt der einfache Holzfäller Paul Ackermann im Moment einer grossen Krise das Gesetz der menschlichen Glückseligkeit, und das lautet: Du darfst! «Im Interesse der Ordnung, zum Besten des Staates, für die Zukunft der Menschheit» ist in der Paradiesstadt Mahagonny alles erlaubt. Die Menschen frönen dem Genuss und der Ausschweifung. Sie fressen, saufen und huren und erteilen der christlichen Moral und dem Jenseitsglaube – in einem von Kurt Weill streng gesetzten Kirchenchoral – eine radikale Absage: »Lasst euch nicht verführen, es gibt keine Wiederkehr», singen sie. «Lasst euch nicht betrügen, dass Leben wenig ist. Schlürft es in vollen Zügen. Es kann euch nicht genügen, wenn ihr es lassen müsst.» Während die Reformation auf den Tugenden des Fleisses, der Bescheidenheit und des Masshaltens aufbaut, propagiert die «Mahagonny»-Oper von Brecht und Weill die totale Entfesselung der Gelüste. Eines ist allerdings in diesem Mahagonny streng verboten: Am Ende nicht zahlen zu können! Diese Erfahrung macht Paul Ackermann, und er kommt dafür auf den elektrischen Stuhl.
Brecht und Weill spielen in ihrem grossformatigen Sittengemäldes den Exzess des Genusses mit einem antichristlichen und, wenn man so will, gegenreformatorischen Furor lustvoll durch. Aber sie wenden den Spass auch gegen sich selbst: Er erstickt an seiner eigenen Zügellosigkeit. Die «Mahagonny»-Autoren statten die geniesserische Kunstform Oper mit all den Theatermitteln der Verausgabung aus, die ihr von jeher zu eigen sind, aber sie üben gleichzeitig scharfe Kritik an ihr. Die Oper sei kulinarisch, schrieb Brecht, aber sie stelle das Kulinarische auch zur Diskussion. Sie greife die Gesellschaft an, die solche Opern benötige.
Steht diese Kritik, die dem Du-darfst-Paradies Mahagonny tief eingeschrieben ist, dann nicht auch in der Tradition des strengen reformatorischen Einspruchs? Wohnt der Oper «Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny», die sich als anarchisch rumorender und spektakulär ausgekosteter Befreiungsschlag gegen jegliche Moral zu erkennen gibt, nicht dennoch etwas Zwinglianisches inne, nämlich der Stachel einer Fundamentalkritik?
Die Neuproduktion des Opernhauses Zürich, die am 5.11. 2017 Premiere hat, wird von dem Brecht-erfahrenen Regisseur Sebastian Baumgarten in Szene gesetzt und von Generalmusikdirektor Fabio Luisi dirigiert. In der schillernden Charakterrolle der Witwe Begbick debütiert der finnische Sopranstar Karita Mattila, die deutsche Sopranistin Anette Dasch gibt die Jenny, und der britische Tenor Christopher Ventris singt den Paul Ackermann.