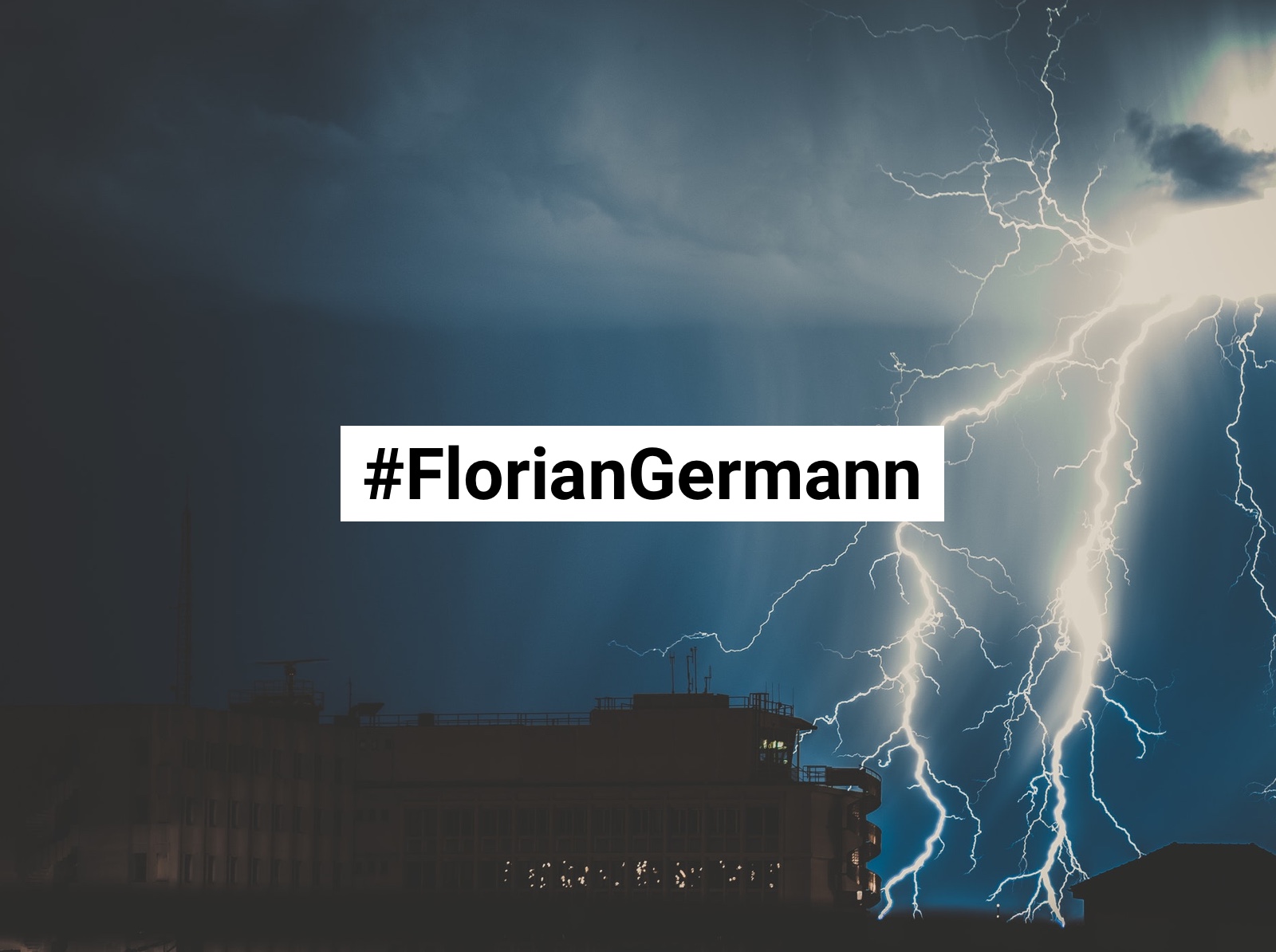Unsere Eltern sagten uns: Lerne, damit du später arbeiten kannst!
Unsere Eltern sagten uns: Verliere ich meine Arbeit, würde ich niemals zur Stütze gehen.
Unsere LehrerInnen sagten uns: Ihr seid die Elite. Ihr müsst an die Uni.
Unsere ProfessorInnen sagten uns: Die Uni ist ein Haifischbecken. Nur die stärksten überleben.
Unsere Chefs sagten uns: Ja, da muss man halt mal was aushalten.
Die Schweizer Universitäten sind zahlbar – und trotzdem in den weltweiten Top 100. Unsere Volksschulen bilden eine Ausgangslage, um es tatsächlich an diese Unis zu schaffen. Die Berufsausbildungen so gut, dass die Matur auch nur für Theorie Versessene der beste Weg ist. In der Schweiz sind wir wie Bakterienkulturen in einer Petrischale: saturiert mit Arbeit, mit Entfaltungsmöglichkeiten, mit Versprechen auf Selbstverwirklichung. We are privileged people. Wir müssen alle essen. Und darum müssen wir arbeiten.
Zwingli rief vor 500 Jahren aus, dass «Mus und Brot» verteilt werden soll, die Forderung hat eingeschlagen im frühmodernen Zürich. Aber wer heute das «Mus und Brot» annimmt, der wird in der Schweiz ausgegrenzt. Denn die grausame Downside von Fast-Vollbeschäftigung, die Downside davon, dass man ab dem Alter von 24 monatliche Anrufe erhält, die einem eine 3.-Säule-Vorsorge andrehen wollen, ist: Nur diejenigen sind wirklich da, wirklich Teil, wirklich anerkannt von der Gesellschaft, die es zu was bringen. Arbeit ist der Boden für Sozialkontakte. Man trifft sich bei der Arbeit, erlebt gemeinsam was – auch unter BuchhalterInnen. Arbeit ist der Boden, um sich Freizeit zu füllen. Weil es ab einem gewissen Alter nicht mehr gern gesehen ist, wenn man seine Abende mit Dosenbier am HB-Treffpunkt verbringt. Oder: Wenn man sich ab einem gewissen Alter mit einer Dose Bier unter die Mondaine-Uhr am HB setzt, muss man in Kauf nehmen, dass man angeglotzt wird. Darum funktionieren wir. Wir trinken nur als Gegenmoment: um zu funktionieren. Im Züriklischee ist «Pröse» oder «Bubbly» der Name des Gesöffs. Der Kater am nächsten Tag ist egal, denn der Ausbruch in den Genuss, das Blackout-Korrektiv steigert den Arbeitsantrieb über die körperliche Verfassung hinweg.
Man kämpft für sich alleine. Kämpft man nicht, bleibt man erst recht für sich alleine. Armut macht einsam. Und die Armut, die sich nicht mit bohèmemässigen Brotlos-Projekten verwirklicht, ist noch einsamer. Drum muss mans zu was bringen. Zum Jungwurster oder Creative Director oder Zugchef oder Whatever-fucking-career-context-you-choose. Alles für deinen Be-Yourself-Share des Alle-gegen-Alle-Spiels.
Drogen: Ein Mittel, um länger zu arbeiten oder ein Mittel für Tabula Rasa zwischen den Arbeitsphasen.
Kernfamilie: Nichts ist an ihre Stelle getreten. Subkulturen wurden durch Szenen ersetzt. Und zwischen Szenen kann man hin- und herhopsen. Verpflichtungsfrei. Ausbildung: Dauert so lange, bis jeder 1977-Dosenbier-Punk sich nur noch auf den Arbeitsmarkt werfen will, wenn er mit 32 sein ZHdK-Diplom in Interaction Design in den Händen hält. Widerstand versiegt.
Wer rebelliert denn in der PostDoc-Phase? Wer hinterfragt eine Institution grundsätzlich, wenn er von befristetem Auftrag zu befristetem Auftrag hechtet? Wer verpflichtet sich für andere – auch gegen den eigenen Vorteil, wenn jeder für sich und seine Selbstverwirklichung werkelt?
Die Maslow‘sche Bedürfnispyramide war mal ein beeindruckendes psychologisches Modell. Heute – das zeigt eine Suche quer durch alle Bibliothekskataloge – wird sie vor allem von den Wirtschaftswissenschaften und PR-Akademien rezipiert. Die Maslow‘sche Bedürfnispyramide sagt: Wer «Mus und Brot», eine Wohnung, langfristige Sicherheit hat, dessen Antrieb wird Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung als höchster Wert ist ein garantiert ewiges Hamsterrad: Was getan ist, ist getan. Aber gibt mir das jetzt das Gefühl ich zu sein? Gibt es ein Hummusrezept, das meine Persönlichkeit widerspiegelt? Und wenn nicht: Wieso nicht das eigene Leben der Entwicklung dieses Hummusrezepts widmen? Kombiniert mit dem Kaleidoskop aus Medienresonanz und Bildungsinstitutionen sorgt das Streben nach Selbstverwirklichung dafür, dass man nie genügt. Selbstzweifel und Minderwertigkeitskomplexe tragen alle schon in sich. Das Konzept Selbstverwirklichung lässt sie wachsen.
Heute braucht es keinen Umweg über Sola Scriptura, damit sich Leute bloss mit ihren eigenen Erfahrungen auseinandersetzen. Heute muss aber auch niemand Lexikonszusammenfassungen von verbotenen PhilosophInnen lesen, um religionskritische Gedankengänge nachzuvollziehen. Heute kann man sagen, denken, lesen, was man will. Glauben, was man will. Vertreten, was man will.
Der Individualismus, der in der Formel «Sola Scriptura» enthalten ist, hat viel für uns getan. Tabus zertrümmert – bis fucking 1972 durften in Züri unverheiratete Pärchen nicht zusammenleben. Eine halbe Generation hat sich von Polizisten prügeln lassen, damit das heute anders ist.
Die Diskussion ums Sein und Bewusstsein fusst heute nicht mehr auf theologischen Positionen. Wessen Werte, wessen Werturteil, die einzelne stärker gewichtet, wird egal, denn das mitteleuropäische Leben im 21. Jahrhundert ist ein moralisches Vexierbild. Entweder gewichten wir unsere eigenen Bedürfnisse, hecheln dem nach, was uns vermeintlich das Gefühl gibt, dass unsere Tätigkeit mit unserer Persönlichkeit zusammenfällt. Oder wir gewichten irgendein «Greater Good» und hecheln genauso, denn im Kaleidoskop gibt es immer nur ein Versuchen, ein Engagement, ein Nadelstich. Nachhaltige Veränderung ist Utopie. Und damit ist das Konzept Utopie ist eine Ebene ferner gerückt. Bereits die Möglichkeit einer Utopie ist utopisch. Es geht immer nur ums Weitermachen.
Wie kann man dem entgegentreten? Soll man dem Individuum entgegentreten? Der ewigen Atomisierung bis alle nur noch für sich selber kämpfen? Das sind grosse Fragen.
Die kleine Antwort: Nein sagen. Kein 1977-Sex-Pistols-Dosenbierpunk-Nein. Sondern sich selbst Grenzen ziehen: Wo lasse ich Genuss zu? Wie viel Hamsterrad-Leben lasse ich zu, um zu erreichen was ich will? Ist es wirklich wichtig, dass ich in der Interaction Designer-Riege auf internationalem Level mithalten kann? Man kann sich darüber streiten, ob Politik ohne Machtgier möglich ist. Man kann aber definitiv sagen, dass Interaction Design ohne Machtgier möglich ist. Und man darf mit grosser Berechtigung fragen, ob Interaction Design (oder irgendeine andere Be-my-true-self-Existenz) nötig ist, wenn sie diesen Antrieb braucht.